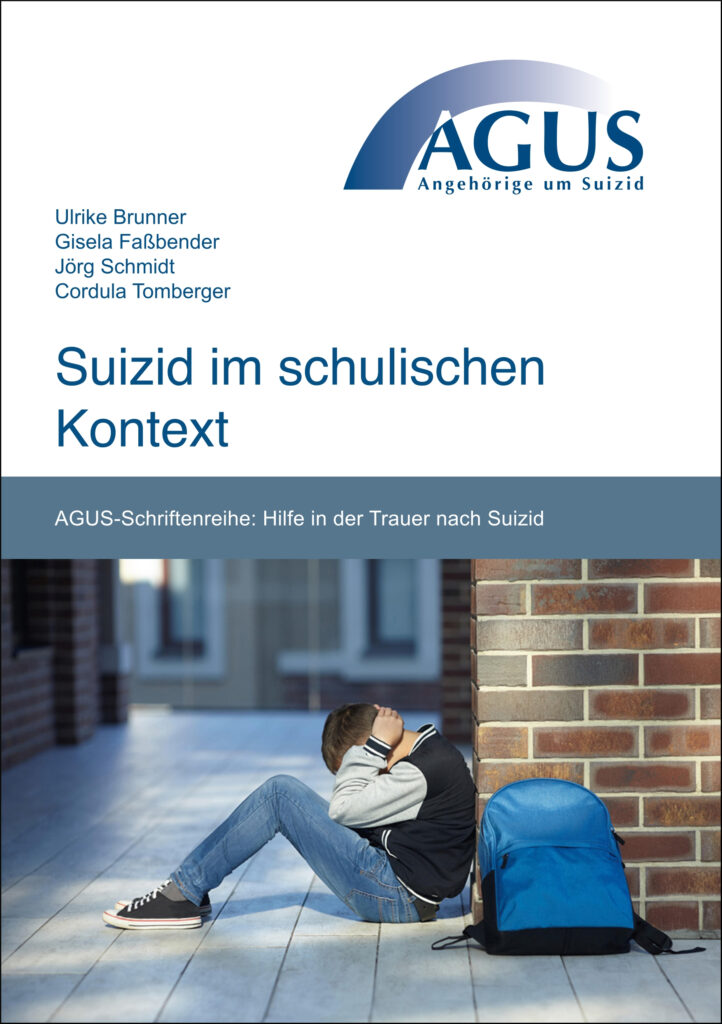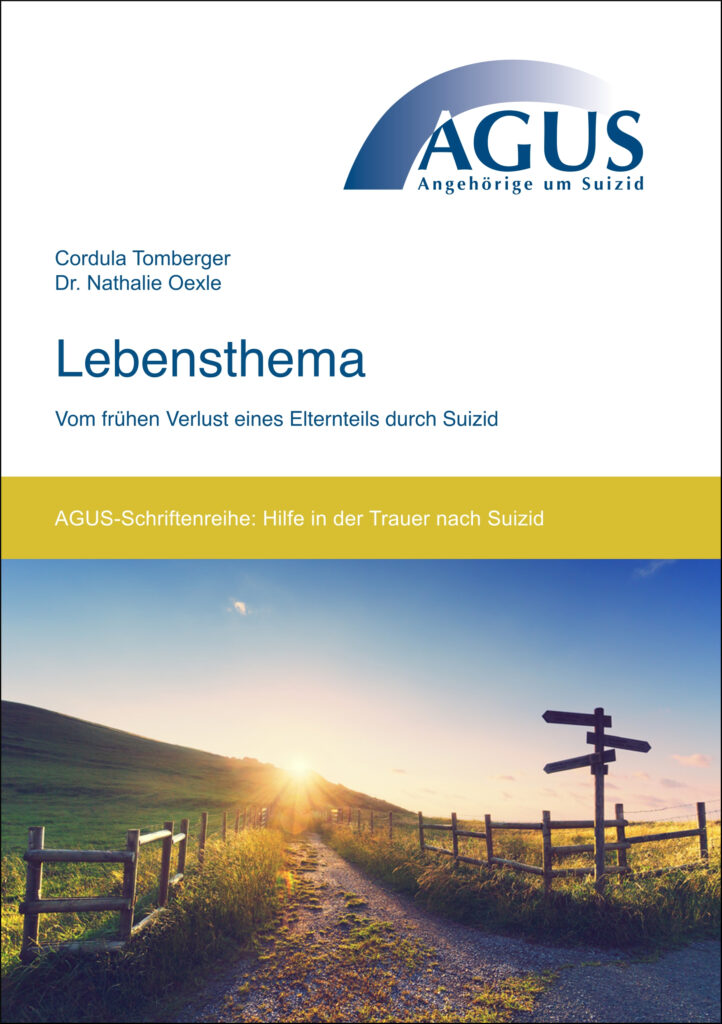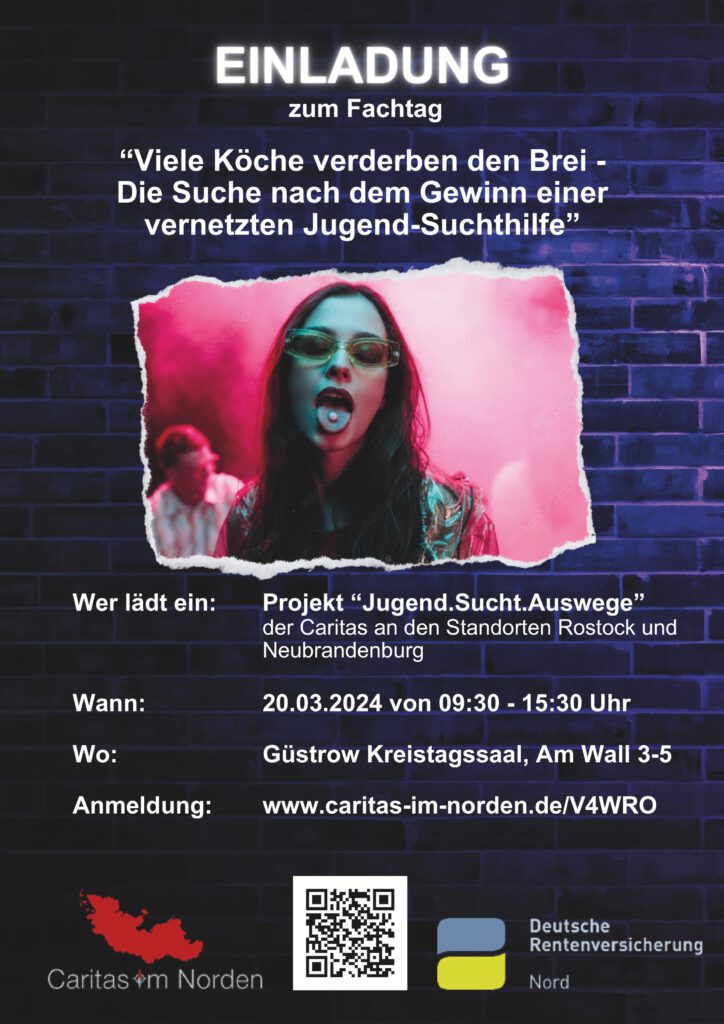An der Universitätsmedizin Hamburg-Eppendorf veranstaltet Thomas Bock jährlich eine Vorlesungsreihe zur Anthropologischen Psychiatrie mit verschiedenen Schwerpunkten. Ziel der Vorlesungsreihe ist, ein menschliches Bild von psychischen Erkrankungen zu vermitteln, sie nicht auf die Abweichung von Normen oder die Folge entgleister Transmitter zu reduzieren. Anlässlich der COVID-19-Pandemie findet seit 2020 die Vorlesungsreihe in digitaler Form statt. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Universität Hamburg mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Irre menschlich Hamburg e.V. und psychenet. Dabei engagieren sich zahlreiche Expert*innen und Psychiatrieerfahrene sowie Angehörige.
Im Wintersemester 2023/ 2024 beschäftigte sich die Vorlesungsreihe unter dem Motto mit dem Erbe des deutschen Sozialpsychiaters Klaus Dörner. Dörners Werk ist vielschichtig und geht weit über die Psychiatrie hinaus. Am 25. September 2022 ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Ausgehend von seinem Werk fanden im Rahmen der Vorlesungsreihe mehrere Dialoge zum Thema „Ist die (Sozial)Psychiatrie heute sozial?“ statt. Die Vorlesungsreihe wurde nun als Videostream veröffentlicht und mit dem Einverständnis der Veranstalter*innen auf dieser Internetseite eingebettet. Unten können die einzelnen Vorlesungen als Videos angesehen werden.
Ist die (Sozial)Psychiatrie heute sozial?
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Michael Schweiger, Prof. Dr. Dirk Richter, Gwen Schulz & Marion Ryan
Klaus Dörner forderte: „Die Psychiatrie ist sozial oder keine“ und wollte einen „Sozialraum, in dem wir leben und sterben, wo wir hingehören“. – Wo stehen wir heute? Sind die Angebote gerecht? Kommen die Schwächsten zu erst? Brauchen wir mehr und andere Politik, um den sozialen Raum lebendig zu gestalten? Was leistet der auch im Vorfeld der Psychiatrie von selbst? Was ist professionelle Aufgabe? Was können wir post-corona lernen – für Jugendliche, Einsame, Alte Menschen? Welche Vermittlung braucht es zwischen familiären und sozialen Ressourcen? Kann Genesungs-Begleitung eine Brücke zwischen Selbst- und Fremdhilfe bilden?
Mit den Schwächsten beginnen
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Michael Wunder, Prof. Dr. Karl Beine, Dr. Dr. Samuel Thoma
Klaus Dörners Auftrag – Was heißt Ringen um die richtige Haltung heute? Im Menschen mit der größten Not begegnen wir jedem Menschen – ein christlicher Ansatz. Doch wird die Psychiatrie dem gerecht? Wo stehen wir heute? Welche Haltung gibt uns Orientierung, damit Therapie nicht nur Ware, der Patient nicht nur Kunde und die Psychiatrie nicht nur Markt ist?
„Bürger und Irre“
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Ute Merkel, Dr. Ralf Seidel, Ralph Höger
Medizingeschichtliche Meilensteine – Was heißt das für die Zukunft? Nürnberger Prozesse und Lehren des NS-Psychiatrie, Wende und Vereinigung mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Psychiatrie in DDR und BRD. Was hat die Psychiatrie notwendig gemacht, was macht sie aus und wo bleibt sie fragwürdig im Sinne eines notwendigen gesellschaftlichen Hinterfragens? Auf diesem Hintergrund brauchen wir Mut und Bescheidenheit, sollten eigentlich mit unserem Hilfesystem „in Zelten leben“ und „in Raumen denken“. Betroffenen und Angehörigen werden dabei mehr prägend sein und (wieder) eine aktive Rolle haben (müssen).
Ende der Ver-Anstaltung
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Charlotte Köttge, Dr. Matthias Heißler, Dr. Bernd Meißnest
Klaus Dörner war überzeigt: Jeder Mensch will tätig sein, braucht eine Wohnung, sein eigenes Leben. Hospitalisierung ist keine Alternative. Wie war es möglich, den Langzeitbereich der Klinik in Gütersloh komplett aufzulösen? Welche politischen Entscheidungen braucht es, damit das überall passiert? Wie können alle Kommunen dem Vorbild folgen, dass Menschen mit Demenz in familienähnlichen Strukturen bleiben. Was ist uns diese Lebensqualität wert? Wie sichern wir diesen Prozess ab – auch für schwererkrankte Menschen? Welche Bedeutung hat der Dritte Sozialraum neben familiären und professionellen Hilfen – erst recht zu Zeiten gesellschaftlicher Alterung und Fachkräftemangel?
„Irren ist menschlich“ – Aber halten Medizin und Pflege in Zukunft das aus?
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Hilde Schädle-Deininger, Ina Jarchov-Jadi & Jessica Reichstein
Das Lehrbuch von Klaus Dörner und Ursula Plog betont den Blick auf das zutiefst Menschliche, fördert eine Suchhaltung, prägt eine dialogische Beziehungskultur – seit über 50 Jahren. Hat all das Psychiatrie und Psychotherapie erreicht und geprägt? Unseren Blick geöffnet für den fließenden Übergang von gesund und krank – sowie die eigenen Krisen? Oder ist das pathologische Denken übermächtig? Die anthropologische Sicht kann die Position der Pflege stärken, zugleich die Multiprofessionalität fördern. Sie ist nötiger und naheliegender denn je, wenn die Psychiatrie sich nach draußen bewegt. Umgekehrt ist nicht alles Menschliche „irre“, brauchen wir Hilfen im sozialen Raum auch unabhängig von der Psychiatrie.
„Was bleibt zu tun?“ – ein trialogischer Rückblick
Mit Gwen Schulz, Prof. Dr. Thomas Bock, Marion Ryan & Dr. Sabine Schütze
Wer sind heute die Schwächsten? Was steht im Vordergrund – Sozialraum oder Anstalt? Halten wir aus, dass Irren menschlich ist? Wieviel Spielraum bleibt fürs Mensch-Sein in Hamburgs Psychiatrie? Kann die Politik helfen, um die privat-/marktwirtschaftlichen Interessen zu stoppen und künftige Psychiatrie sozial zu gestalten? Wie sieht der Trialog Klaus Dörner?