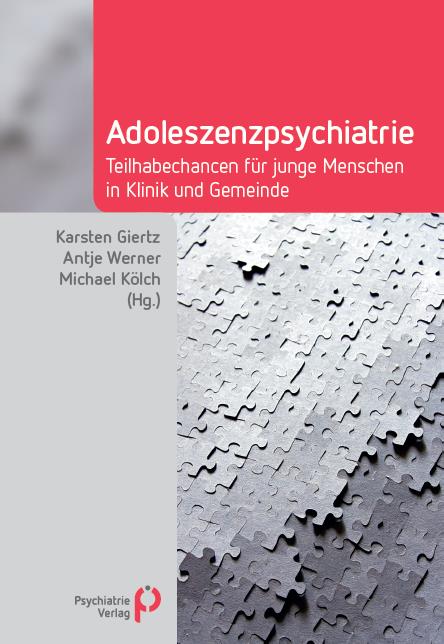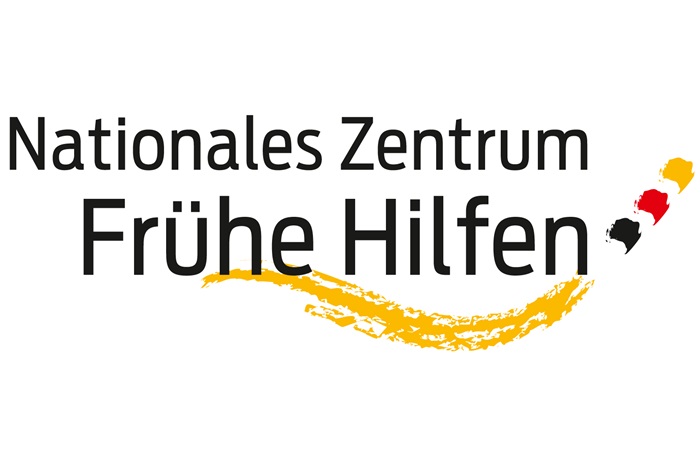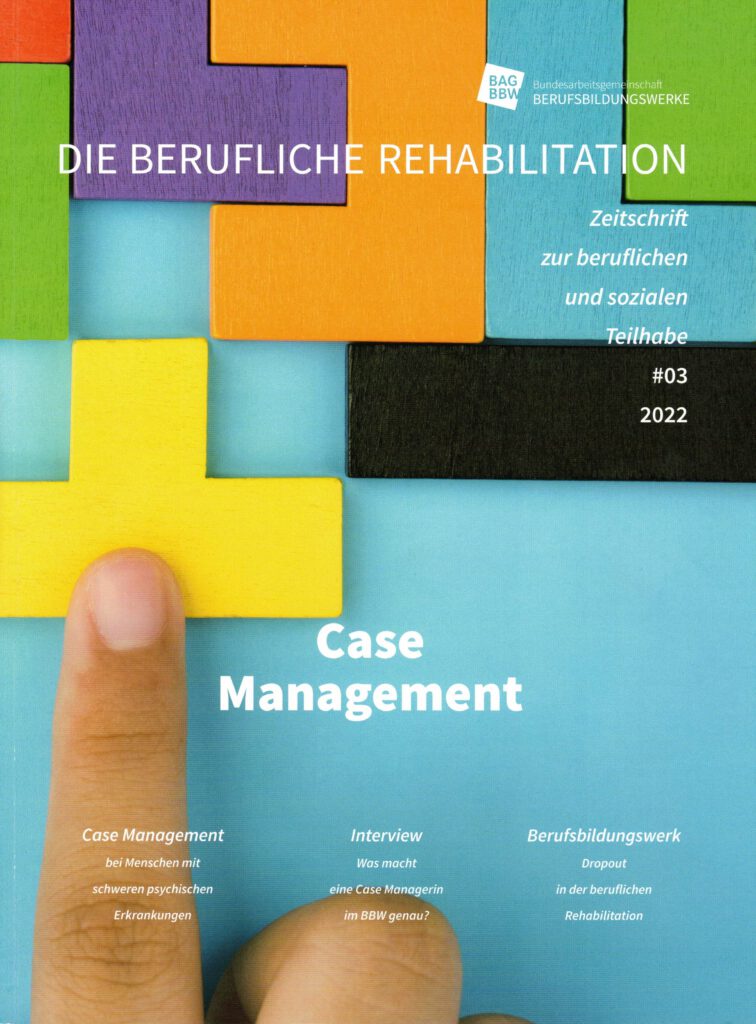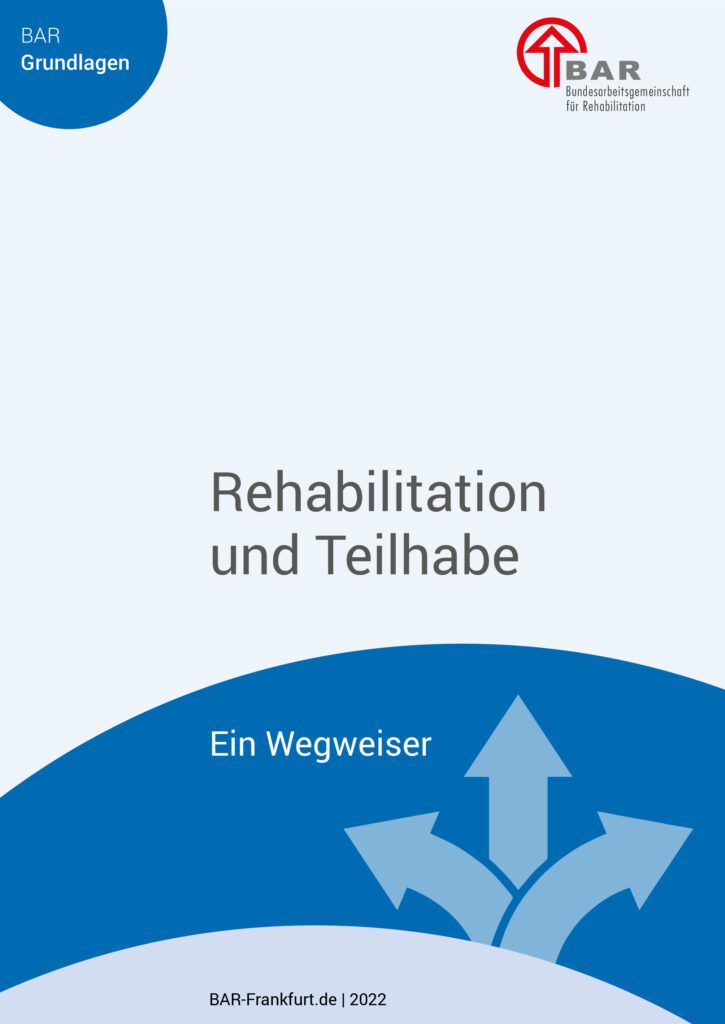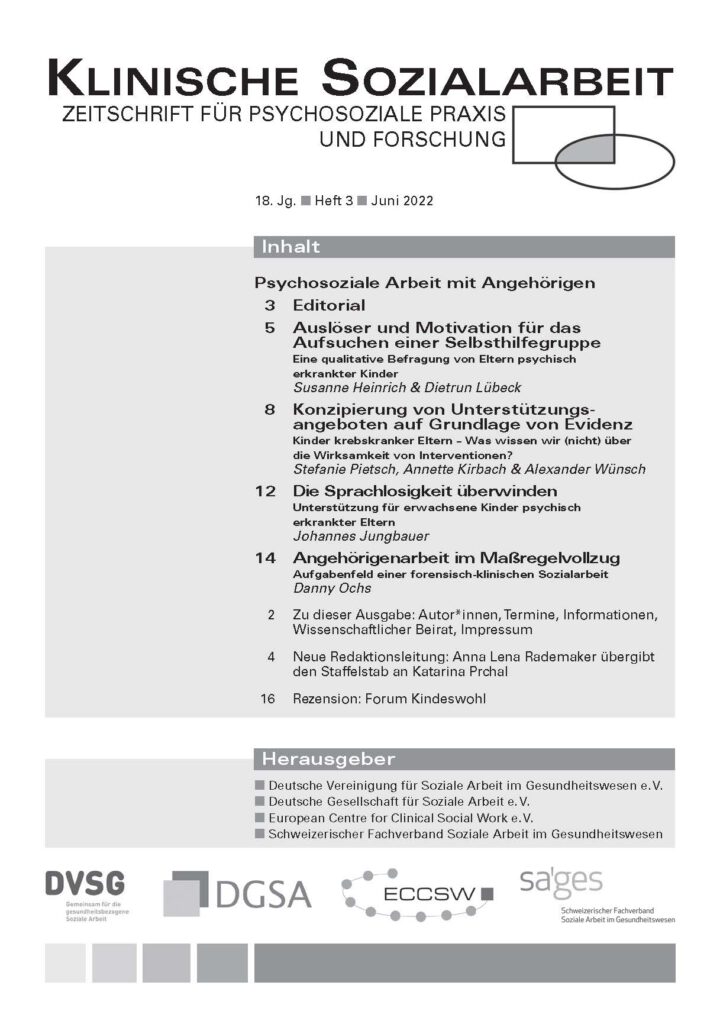Professionell Tätige werden in der psychosozialen und psychiatrischen Praxis immer wieder mit Patient*innen und Klient*innen konfrontiert, zu denen es einfach nicht gelingt einen angemessenen Zugang zu finden und die die Mitarbeitenden regelmäßig an die professionellen Grenzen bringen. Zur Bezeichnung dieser Zielgruppe hat sich in der Fachliteratur der Klinischen Sozialarbeit der kontrovers diskutierte Begriff “hard to reach” (dt. schwer erreichbar) durchgesetzt. Gemeint sind Klient*innen oder Patient*innen mit komplexen Problemlagen, komorbiden Erkrankungen, herausfordernden Verhaltensweisen und existenziellen Schwierigkeiten, welche aus der Perspektive der Professionellen eine Integration in die bestehenden Behandlungs- und Unterstützungsangebote erschweren. Oftmals wirken bei Ihnen psychische Erkrankungen und Beeinträchtigungen in der Lebenswelt zusammen, wodurch sie häufig von Exklusionsprozessen bedroht sind und nicht in der beabsichtigten Weise von den vorhandenen Unterstützungsangeboten profitieren.



Unter dem Motto “Systemfehler? Schwer zu erreichen ist nicht unerreichbar” fand in diesem Jahr die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP) in Leipzig statt. In Anlehnung an das von Karsten Giertz (Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Lisa Große (Alice Salomon Hochschule Berlin) und Silke B. Gahleitner (Alice Salomon Hochschule Berlin) 2021 herausgegebene Fachbuch “Hard to reach: Schwer erreichbare Klientel unterstützen”, beschäftigte sich die Fachtagung kritisch mit der aktuellen Versorgungssituation von sogenannten Hard-to-reach-Klient*innen in der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung. Zur Einstimmung in die Thematik organisierte die Stiftung Soziale Psychiatrie am Tagungsvorabend gemeinsam mit den Herausgebenden Lisa Große und Karsten Giertz eine Lesungsveranstaltung zum Buch “Hard to reach: schwer erreichbare Klientel unterstützen”. In der anschließenden Diskussion mit den Teilnehmer*innen wurden verschiedene fachliche Perspektiven und Handlungsbedarfe bei dieser Zielgruppe diskutiert.

Weitere Informationen zur Stiftung Soziale Psychiatrie finden Sie hier. Informationen zum Buch “Hard to reach: Schwer erreichbare Klientel unterstützen” und zu den Herausgebenden können Sie hier abrufen.