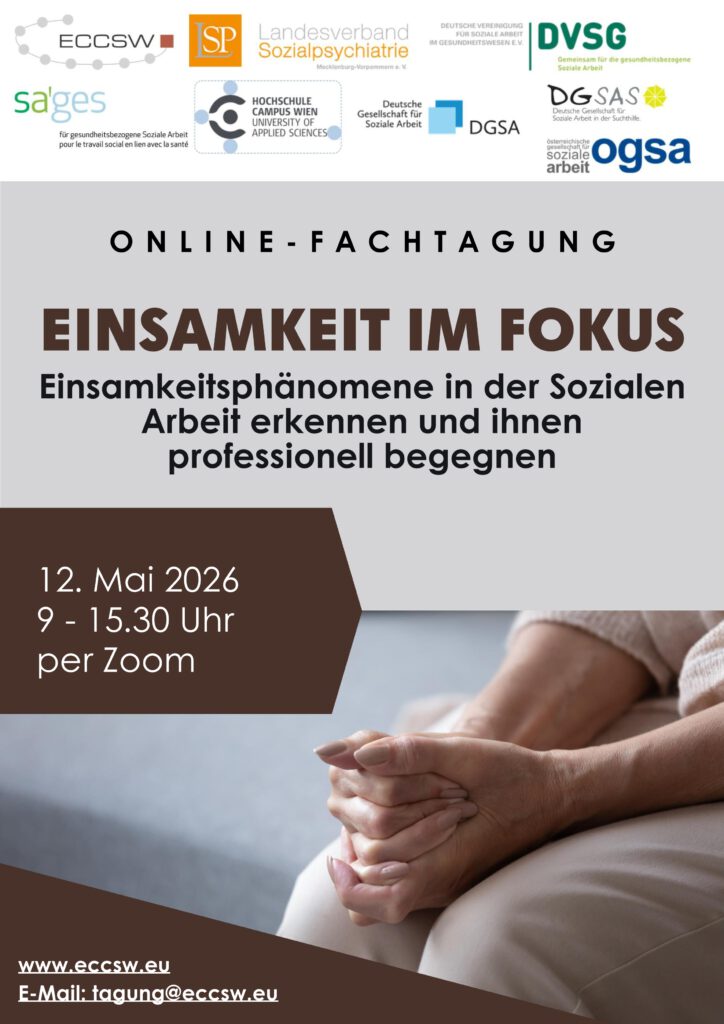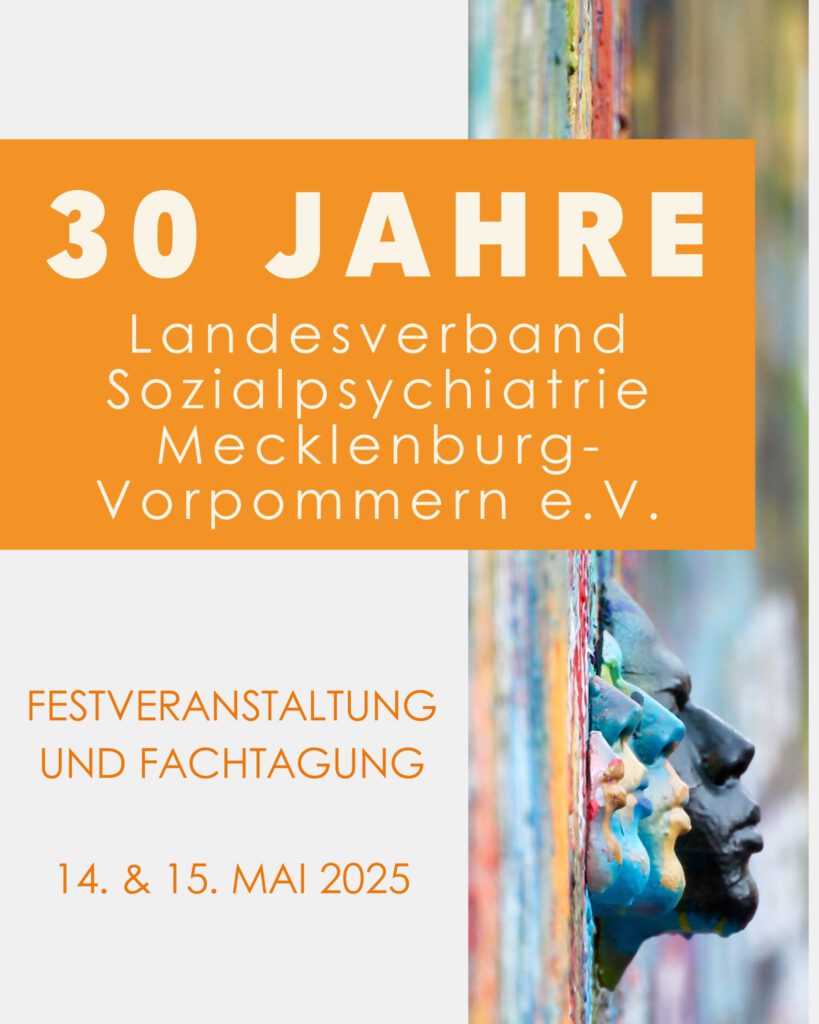An der Universitätsmedizin Hamburg-Eppendorf veranstaltet Thomas Bock jährlich eine Vorlesungsreihe zur Anthropologischen Psychiatrie mit verschiedenen Schwerpunkten. Ziel der Vorlesungsreihe ist, ein menschliches Bild von psychischen Erkrankungen zu vermitteln, sie nicht auf die Abweichung von Normen oder die Folge entgleister Transmitter zu reduzieren. Anlässlich der COVID-19-Pandemie findet seit 2020 die Vorlesungsreihe in digitaler Form statt. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Universität Hamburg mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Irre menschlich Hamburg e.V. und psychenet. Dabei engagieren sich zahlreiche Expert*innen und Psychiatrieerfahrene sowie Angehörige.
Unter dem Motto „Seelische Not von jungen Menschen“ geht Thomas Bock im Sommersemester 2025 mit Angehörigen, Psychiatrie-Erfahrenen und Praktiker*innen in den Austausch über die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen und ihre seelische Not im Zusammenhang mit ADHS, Long Covid und anderen Corona-Langzeitfolgen sowie im Umgang mit der Wechselwirkung von Psychose und Sucht.
Angst von Kindern und Jugendlichen um die Welt – Aufgabe der Psychiatrie?
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Anne Kaman, Olaf Neumann und Simon Schultheiss
Kinder und Jugendlichen geht es zwar seelisch besser als direkt nach Corona; doch deutlich schlechter als vorher. Die Sorgen um die Welt, Krisen und Kriege haben explizit zugenommen. Politisch kann dieses Ergebnis der aktuellen COPSY-Studie (Corona und Psyche) nicht wirklich überraschen. Gleichzeitig erschreckt es: Die seelische Gesundheit, das innere Gleichgewicht, der innere Frieden der nächsten Generationen sind nicht irgendwann bedroht, sondern jetzt! Wer ist mehr, wer weniger betroffen? Welche Risiko- und welche Schutzfaktoren gibt es? Was folgt daraus – für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Familie, Schule, Gesellschaft und Politik? Dr. Anne Kaman (wiss. Mitarbeiterin, Kinder- und Jugendpsychiatrie UKE) berichtet von den Ergebnissen, der Geschichte und den Konsequenzen der Studie. Simon Schultheiss (Irre menschlich Hamburg) schildert seine persönliche Erfahrung mit der Wechselwirkung von äußerer und innerer Welt sowie von der Herausforderung, so etwas wie Stigma-Resistenz zu entwickeln (z.B. Zu-sich-stehen-Gruppen), Olaf Neumann seine Sicht als Pflegeleiter einer Adoleszentenstation auf politische Bedrohung und Stigma-Risiko.
Warum hört das nicht auf? Long Covid und andere Corona-Langzeitfolgen
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Prof. Dr. Michael Stark und Jennifer Nielsen
COVID macht Jugendlichen nicht mehr soviel Angst, ist politisch im Hintergrund, von anderen Krisen abgelöst worden. Doch die sozialen Folgen wirken nach, ebenso wie die damalige Spaltung der Gesellschaft. Schwierigkeiten der Verständigung gibt es auch bei Long Covid. Da sei „keine psychische Erkrankung“! Was aber dann? Warum wirken manche Infektionen in Autoimmun-Reaktionen lange nach, andere nicht? Was bedeutet es, so lahm gelegt zu sein? Wie kränkend und stigmatisierend wirkt die übliche Reaktion der Medizin? Was hilft wirklich? Welche Forschung tut not? Und was hat das Ganze mit dem Zustand der Welt zu tun? Ein Gespräch mit Prof. Michael Stark – Facharzt, Forscher, Therapeut für chronische Erschöpfungskrankheiten, der aus der Sozialpsychiatrie kommt – und Jennifer Nielsen; sie ist krankheitserfahren und mit dieser Erfahrung Angestellte im Fatigue Zentrum.
Henne oder Ei? Wechselwirkung von Psychose und Sucht
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Marion Ryan, Amon Barth und Dr. Aljosha Deen
Werden Psychosen durch Drogen ausgelöst? Oder sind Drogen, ein Versuch, sich abzudichten gegen präpsychotische Durchlässigkeit? Wie facettenreich ist diese Wechselwirkung? Was hilft? Was bringt den Wendepunkt im Leben – auch jenseits des Hilfesystems? Welche Rolle spielen Spiritualität, neue Lebensaufgaben, Beziehungen? Und jenseits von „Henne oder Ei?“: Wie lebt die Henne? – Wie wird das Hilfesystem erlebt? Wie akzeptierend und niedrigschwellig kann/muss Hilfe sein? Wie überwinden wir die Trennung der Behandlungsstrukturen nachhaltig? Wie erreichen wir auch die, die über die Doppelerfahrung wohnungslos werden? Ein trialogisches Gespräch von Thomas Bock mit Dr. Aljosha Deen (Oberarzt Asklepios Klinik Nord), Marion Ryan (Angehörige), Amon Barth (Autor)
ADHS – Viel Aufmerksamkeit für ein Defizit!
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Astrid Neuy-Lobkowicz, PD Dr. Daniel Schöttle und Dr. Johannes Streif
Den „Zappelphilipp“ hat der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann bereits 1844 erfunden. Nun sprechen wir von „Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität“. Wie groß ist das Risiko, ein komplexes familiäres, schulisches, psychotherapeutisches, kulturelles Problem auf eine psychiatrische Intervention zu reduzieren? Aktuell gibt es eine große Aufmerksamkeit für dieses „Defizit“ – aber ist es überhaupt immer eins? Bedeutet das Selbstverständnis als „neurodivers“ einen kulturellen Fortschritt in Richtung Emanzipation oder im Gegenteil einen biologischen Reduktionismus? – Auf der einen Seite gibt es eine Überidentifikation mit der Diagnose (z.B. in den sozialen Medien), auf der anderen Seite wird eine Unterversorgung konstatiert – wie passt das zusammen? Wie unterscheiden sich Symptomatik und therapeutische Konsequenzen bei Jungen und Mädchen, Jugendlichen und Erwachsenen? Welche Rolle spielt die Selbstmedikation mit Drogen? Welche Rolle spielen die Angehörigen? Mehr Bewegung oder mehr Ritalin – wieviel Spielraum bleibt? Was kann eine ganzheitliche Behandlung aussehen? Wo und wie kann jede/r für sich Klärung finden?
Ein Gespräch mit dem selbst erfahrenen Psychologen Dr. Johannes Streif (Sprecher von ADHS Deutschland), mit PD Dr. Daniel Schöttle (Chefarzt Asklepios Klinikum Harburg) und mit Dr. med. Astrid Neuy-Lobkowicz (Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und zugleich Mutter und selbst erfahren).
Was folgt? Ein trialogischer Rückblick
Mit Prof. Dr. Thomas Bock, Marion Ryan, Gwen Schulz und Dr. Sabine Schütze
Wenn Jugendliche ihre seelisch Not gesellschaftliche begründen, ist das alarmierend und ermutigend zugleich. Doch was folgt? Wenn die Unruhe zunimmt, Corona nicht aufhört und Corona-Folgen nachwirken, wer ist zuständig? Wenn es beim Thema ADHS gleichzeitig zu hohe und zu niedrige Schwellen gibt, was folgt daraus? Wenn Psychose und Sucht nicht nur in Wechselwirkung stehen, sondern es dahinter auch um sehr reale soziale Konflikte und oft auch umprekäre Lebensbedingungen geht, wer zieht therapeutische, wer politische Konsequenzen? Wenn Symptome überdauern, wieviel Geduld haben wir? Wenn sich Menschen nicht als krank, sondern divers verstehen, hat das emanzipatorische oder resignative Bedeutung?