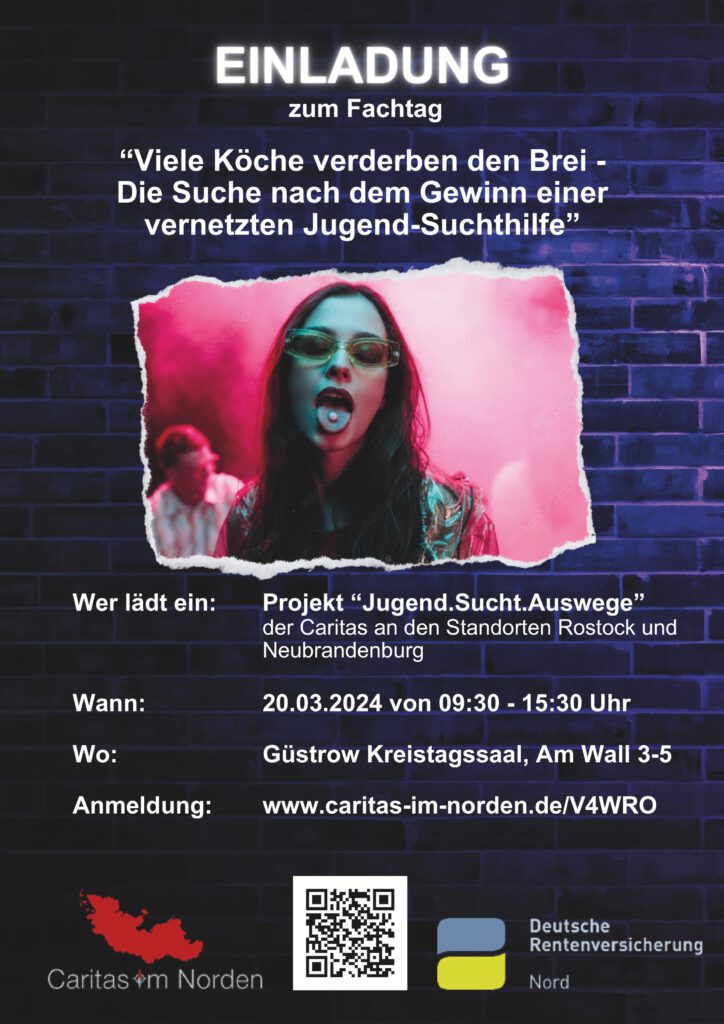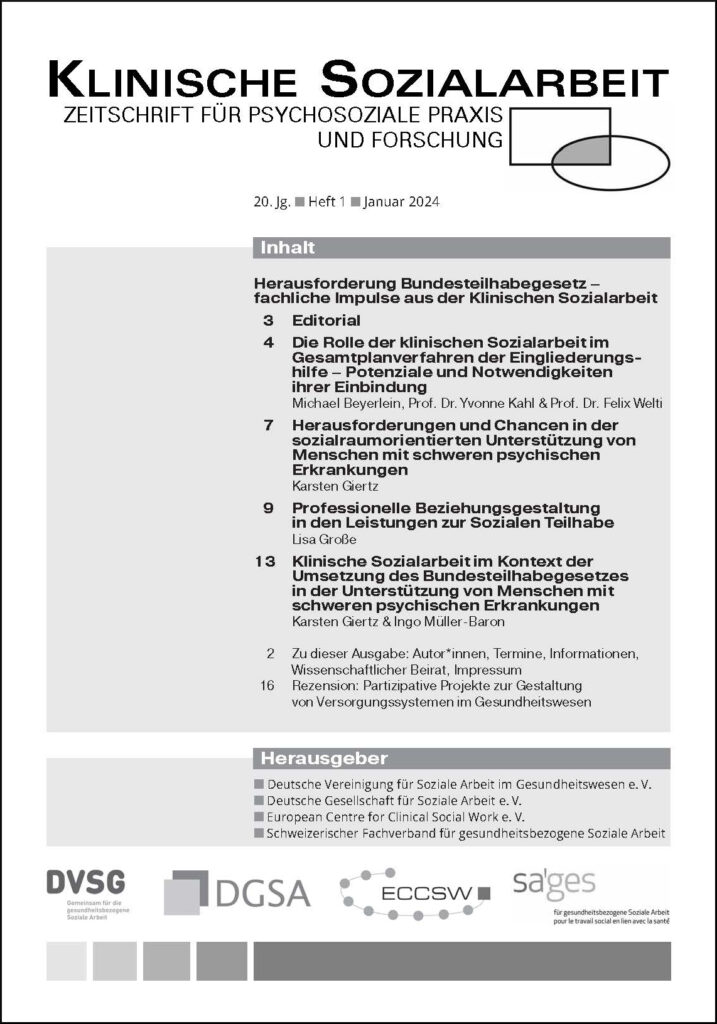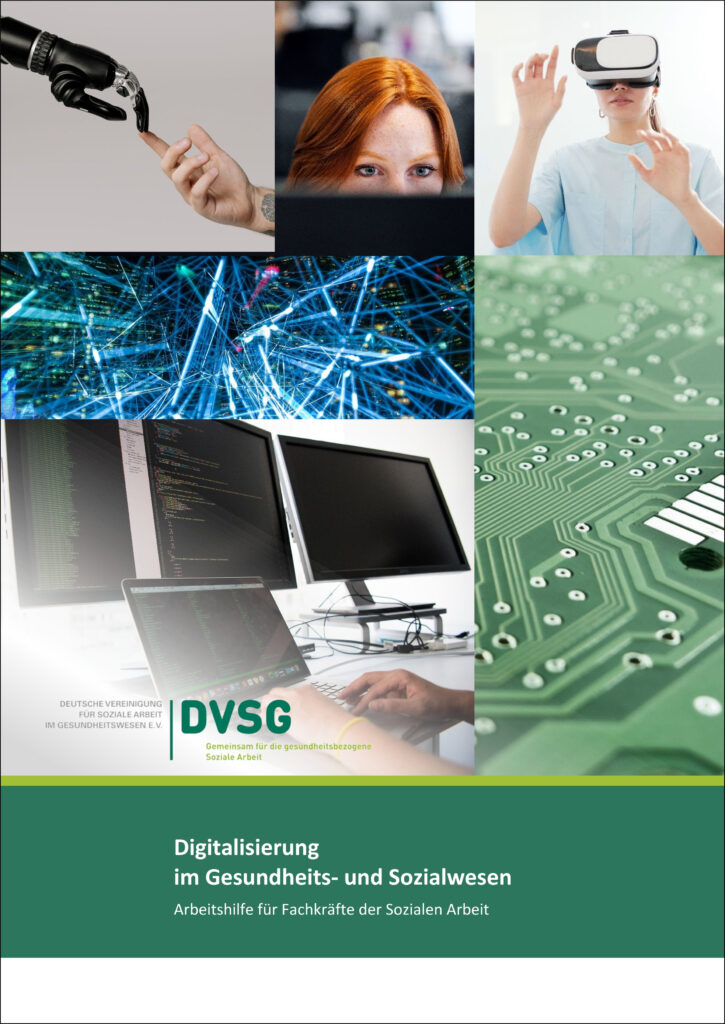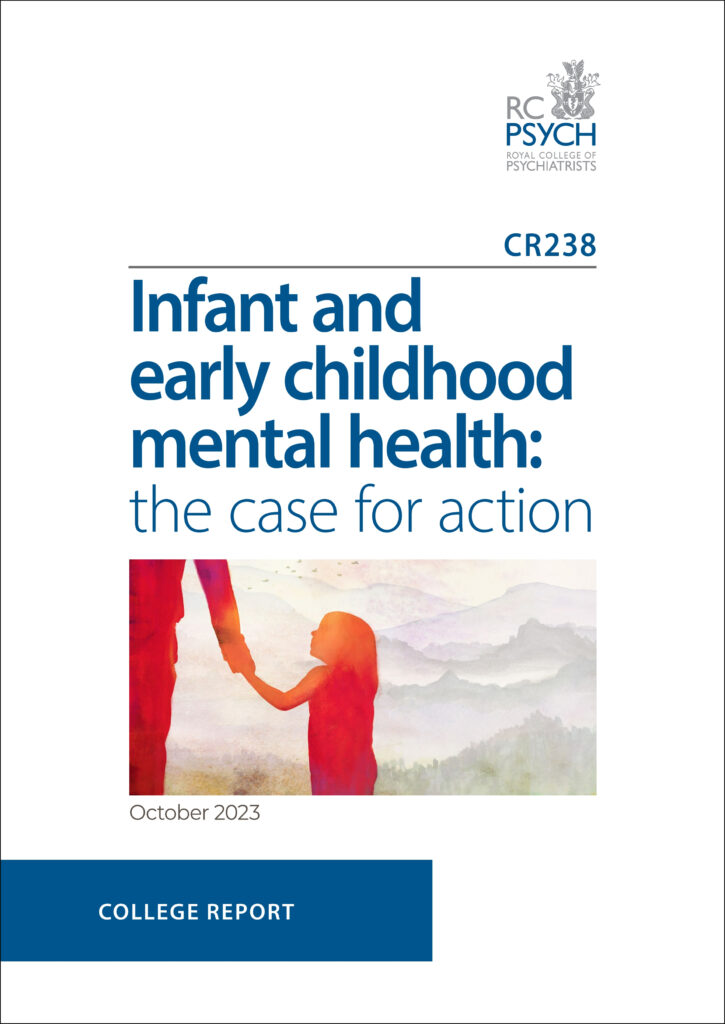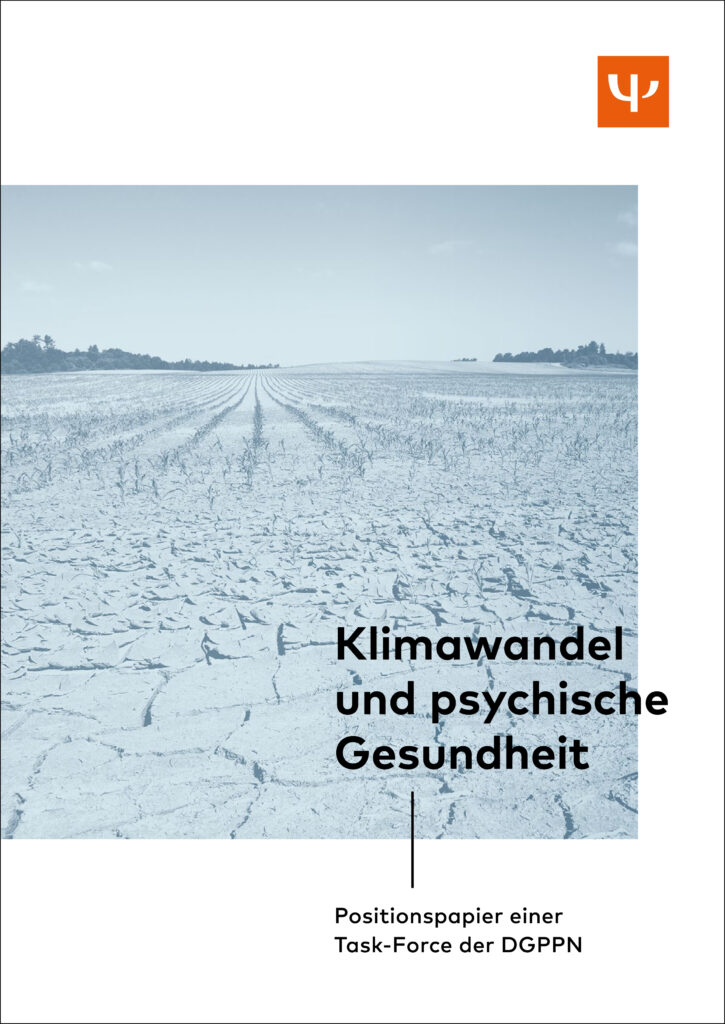Etwa jede zehnte Person in Deutschland erkrankt an einer Persönlichkeitsstörung. In vielen Angeboten der psychiatrischen, psychosozialen und psychotherapeutischen Versorgung gehören Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung zu einer häufig anzutreffenden Zielgruppe.
Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung sind in starren Denk- und Handlungsweisen gefangen. Ihnen gelingt es nicht oder nur begrenzt, sich auf wechselnde Situationen einzustellen und flexibel damit umzugehen. Ihre einseitigen, oft unangemessenen Reaktionen können das soziale Miteinander stark beeinträchtigen und zu Konflikten führen. Viele Betroffene leiden zum Teil erheblich darunter. Nicht selten verstehen sie jedoch nicht, warum ihr Verhalten in ihrem Umfeld auf Unverständnis stößt.
Obwohl es mittlerweile zahlreiche wirksame Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung gibt, erhalten oft nur wenige Betroffene die notwendige Behandlung und Unterstützung. Zahlreiche Studien legen nahe, dass Persönlichkeitsstörungen allgemein mit einer guten Prognose einhergehen und selten einen chronischen Erkrankungsverlauf aufweisen, zumindest wenn Betroffenen einen Zugang zu entsprechenden Behandlungs- und Unterstützungsangeboten erhalten. Trotz der guten Prognose zählen Betroffen mit einer Persönlichkeitsstörung aufgrund ihrer auffälligen Verhaltensmuster immer noch zu einer Personengruppe, die – auch aufseiten des professionellen Unterstützungssystems – negativen Zuschreibungen und gesellschaftlichen Stigmatisierungstendenzen ausgesetzt ist.
Die neue Broschüre „Persönlichkeitsstörung – was ist das?“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung versucht den negativen Vorurteilen und Zuschreibungen gegenüber Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung entgegenzuwirken. Darüber hinaus informiert die Broschüre Betroffene und Angehörige über die Entstehung und Symptome von Persönlichkeitsstörung sowie über deren Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Die Broschüre ist als kostenloser Download hier verfügbar.