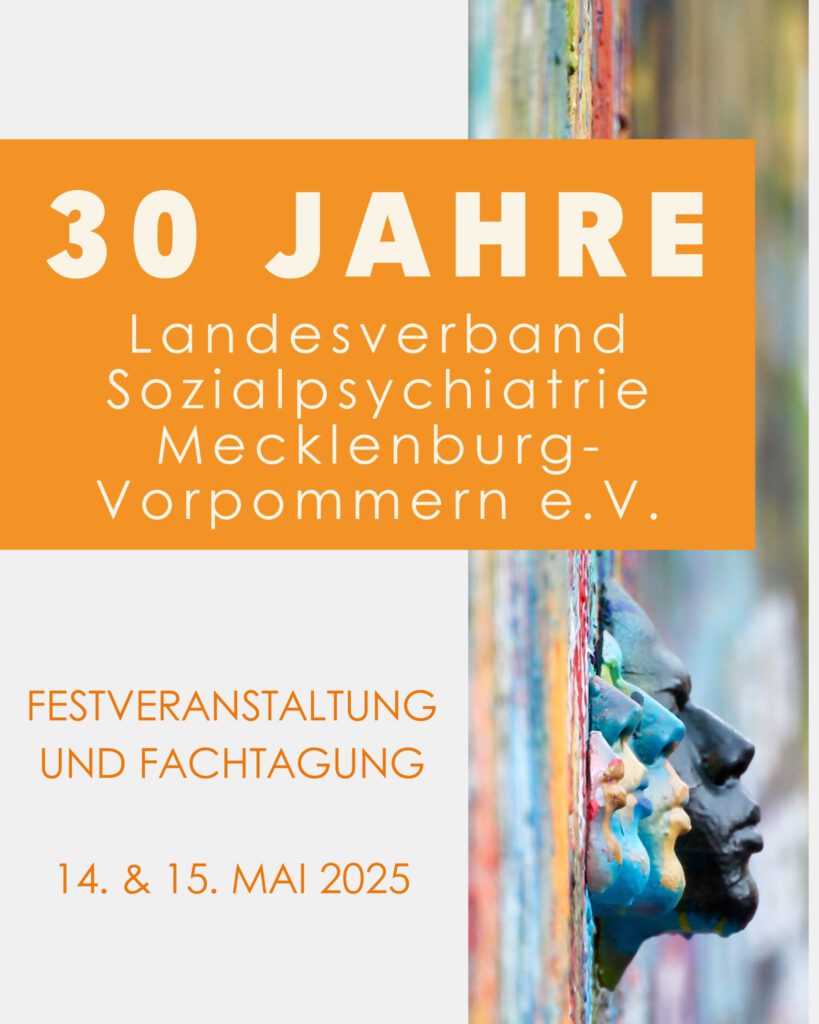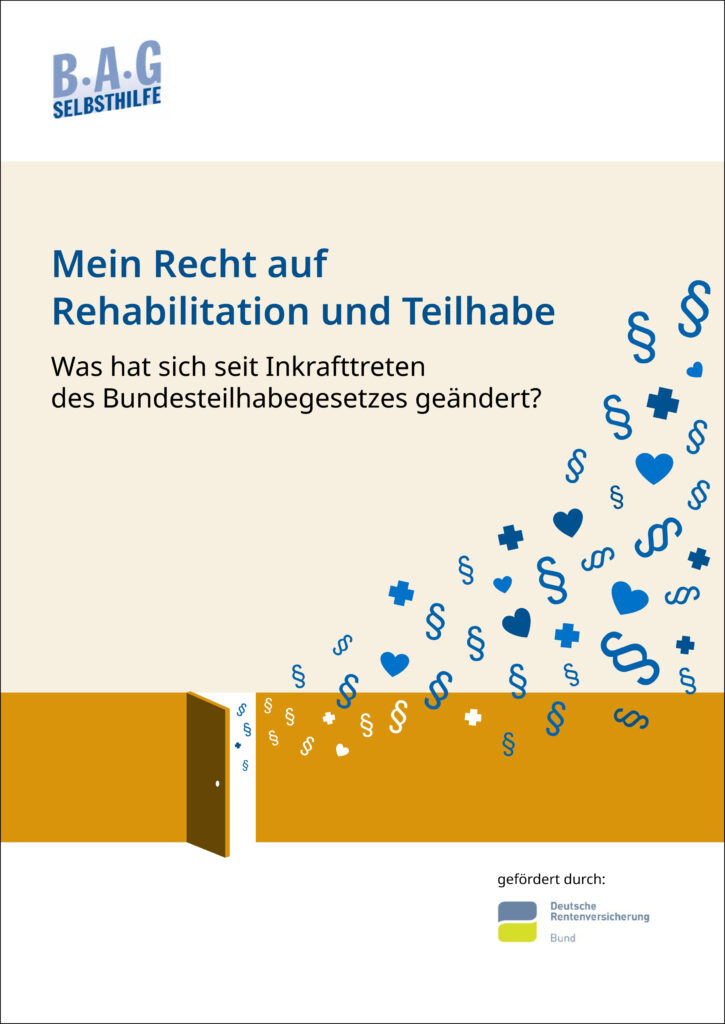Bei der Entwicklung, Planung und Evaluation von psychiatrischen und psychosozialen Behandlungs- und Unterstützungsangeboten hat in den letzten Jahren die partizipative Einbeziehung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch Selbsthilfeinitiativen und -bewegungen, durch zunehmende Forschungsaktivitäten sowie durch gesetzliche Reformprozesse wie die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz an Bedeutung gewonnen.
Gerade durch das Bundesteilhabegesetz wurde die gesetzlich verpflichtende Grundlage für Leistungsträger und Leistungserbringer geschaffen, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit anderen Behinderungen aktiv und auf gleicher Augenhöhe in die Planung, Durchführung und Evaluation von psychiatrischen und psychosozialen Unterstützungsangeboten einzubeziehen. Zudem ist die partizipative Beteiligung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eng mit den Konzepten von Empowerment und Recovery verbunden.

Um die aktive Beteiligung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung sowie die Implementierung von Angeboten des Peer Supportes in Mecklenburg-Vorpommern zu fördern, entwickelten der Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V., der Verein EX-IN Mecklenburg-Vorpommern e.V. und das Diakoniewerk Mecklenburg-Vorpommern e.V. die Initiative der Landesarbeitsgruppe Partizipation Mecklenburg-Vorpommern, welche gemeinsam mit anderen interessierten Kooperationspartner*innen und Verbänden umgesetzt wird.
Am 11. Juni 2025 findet im Café Marat, Peter Weiß Haus, Doberaner Str. 21, 18057 Rostock das nächste Treffen der Landesarbeitsgruppe Partizipation statt. Die Teilnahme ist kostenlos und sowohl in digitaler Form als auch in Präsenzform möglich. Interessierte Personen, Mitarbeiter*innen aus der psychiatrischen Versorgung, Psychiatrieerfahrene und Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen sind eingeladen, sich am Austausch innerhalb der Landesarbeitsgruppe zu beteiligen.
Die Einladung mit der Tagesordnung und den Informationen für die Anmeldung finden Sie hier:
Weitere Informationen zur Initiative der Landesarbeitsgruppe Partizipation Mecklenburg-Vorpommern können Sie hier einsehen.