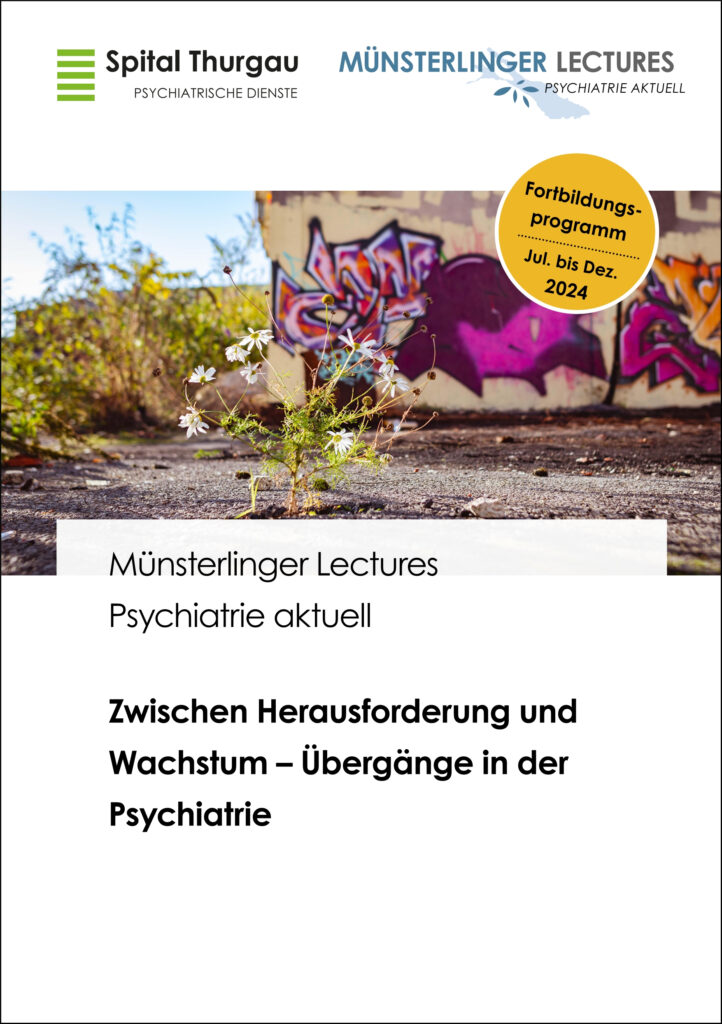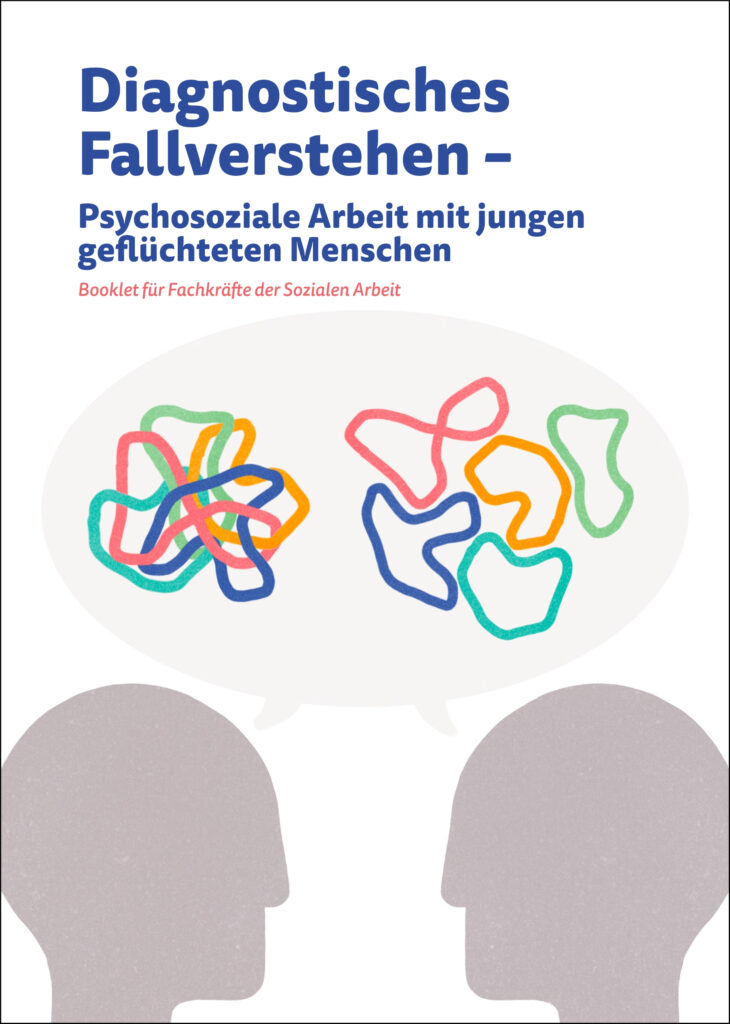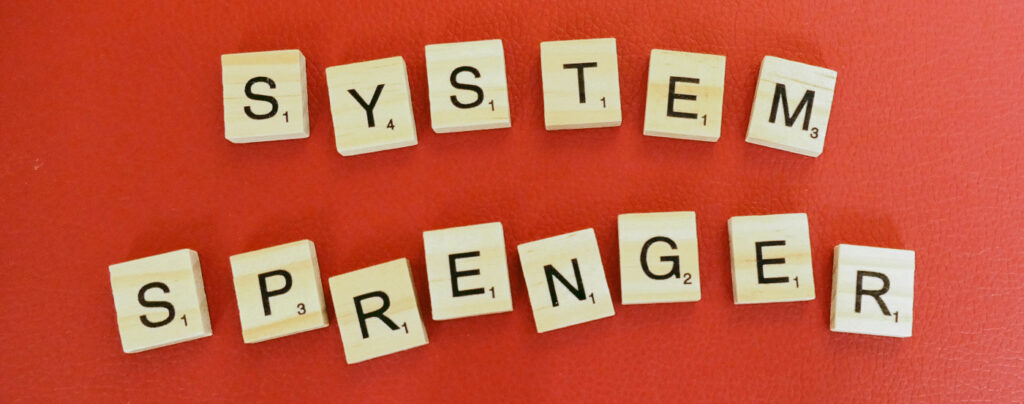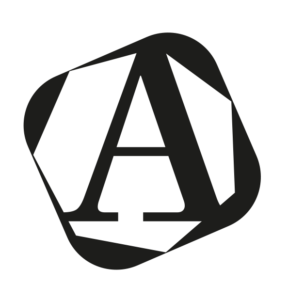30 Jahre Einsatz für psychische Gesundheit – Der Landesverband Sozialpsychiatrie MV e.V. feiert sein Jubiläum am 14. Mai 2025 in Schwerin

Seit drei Jahrzehnten engagiert sich der Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Gegründet 1995, setzt sich der Verband zusammen aus Organisationen, Vereinen und Institutionen, die in Mecklenburg-Vorpommern Menschen mit psychischen Erkrankungen beraten, behandeln und unterstützen. Ziel ist des Verbandes ist es, die psychiatrische und psychosoziale Versorgung weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen von psychisch belasteten Menschen und ihren Angehörigen zu verbessern. “Wir sind stolz auf unsere 30-jährige Geschichte, in der wir uns als unabhängiger Fachverband in Mecklenburg-Vorpommern etablieren und Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Stimme geben konnten”, sagt Vorstandsvorsitzende Sandra Rieck. „Diesen Auftrag nehmen wir auch in Zukunft ernst, besonders vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, der zunehmenden gesellschaftlichen Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie der drohenden Ausgrenzung durch Kosteneinsparrungen im Sozial- und Gesundheitswesen.“

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, setzt der Verband mit der Unterstützung von zahlreichen Kooperationspartner*innen, verschiedene Initiativen und Projekte um. So erinnert seit 2008 jährlich am 27. Januar eine landesweite Gedenkveranstaltung an die Opfer der NS-Euthanasie. Ein Psychiatriewegweiser unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der Suche nach geeigneten Hilfsangeboten in Mecklenburg-Vorpommern. Um Kinder aus psychisch belasteten Familien zu stärken, wurde 2023 die Landesfachstelle KipsFam gegründet. Der Verband beteiligt sich zudem an dem Präventionsprogramm „Verrückt? Na und!“, das Schulkinder über psychische Gesundheit aufklärt, und schult Laien mit dem Kurs „Mental Health First Aid“ in der Ersten Hilfe bei psychischen Krisen.



Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde das Jubiläum am 14. Mai 2025 im Hotel Elefant in Schwerin gefeiert. Zahlreiche Mitglieder, Gäste und langjährige Weggefährten des Verbandes beteiligten sich an dem Festakt. In ihren Grußworten gingen Nils Greve (Vorstandsvorsitzende des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e.V.), Dr. Rainer Kirchhefer (Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg) sowie Dr. Antonia Kowe (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport) auf die Bedeutung des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. für die psychiatrische und psychosoziale Versorgung von Mecklenburg-Vorpommern ein. Zudem gaben Sandra Rieck (Vorstandsvorsitzende und Gründungsmitglied des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Frank Hammerschmidt (Projektmitarbeiter Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.) und Dr. Michael Köpcke (ehemalige Leitung des Referates Psychiatrie, Maßregelvollzug, Sucht und Prävention des Gesundheitsministeriums Mecklenburg-Vorpommern) einen Überblick zur dreißigjährigen Geschichte des Verbandes.
Ein Videorückblick zur Festveranstaltung finden Sie hier im internen Mitgliederbereich des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. und einen freien Filmbeitrag zur Festveranstaltung und Fachtagung vom Sender MV1 finden Sie hier.
Fachtagung “Kooperation und kooperative Behandlungs- und Unterstützungsformen in der psychiatrischen Versorgung: Perspektiven nach 50 Jahren Psychiatrie-Enquete” am 15. Mai 2025 in Schwerin
Jährlich weisen etwa 28 Prozent der Erwachsenen und 23 Prozent der Kinder- und Jugendlichen in Deutschland Merkmale einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung auf. Rund ein bis zwei Prozent von ihnen leiden an den schweren und langanhaltenden Auswirkungen ihrer psychischen Erkrankung, die mit einer intensiven Inanspruchnahme von psychiatrischen und psychosozialen Beratungs-, Behandlungs- und Unterstützungsangeboten einhergehen. In der angloamerikanischen Fachliteraturetablierte sich zur Bezeichnung dieser Zielgruppe der Begriff „Severe Mental Illness“ (dt.„schwere psychische Erkrankungen“).

Im Zuge der Psychiatrie-Enquete hat sich in den letzten 50 Jahren für die Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen in Deutschland ein differenziertes Versorgungssystem mit verschiedenen Beratungs-, Behandlungs- und Unterstützungsformen entwickelt. Dennoch weisen betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene noch immer zahlreiche psychosoziale Gesundheitsbeeinträchtigungen und gesellschaftliche Teilhabeeinschränkungen auf. So gehen schwere psychische Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung mit einem erhöhten Risiko für Beschäftigungslosigkeit, Armut, Verschuldung, Wohnungslosigkeit, Viktimisierung, komorbide somatische Erkrankungen und mit einer vorzeitigen Sterblichkeit einher. Gerade im Bereich der Sozialen Teilhabe ist das Risiko für Exklusionsprozesse besonders hoch. Darüber hinaus gehören Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen immer noch zu einer Zielgruppe, die erheblichen Stigmatisierungsprozessen und einstellungsbedingten Barrieren in der Bevölkerung ausgesetzt ist.




Aufgrund dieser Risiken bedarf es in der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung systemübergreifender und nachhaltiger kooperativer Behandlungs- und Unterstützungsformen, um Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen adäquat zu versorgen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Psychiatrie-Enquete und des 30-jährigen Jubiläums des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. beschäftigte sich die Fachtagung mit dem Thema „Kooperation und kooperative Behandlungs-, Rehabilitation- und Unterstützungsformen in der psychiatrischen Versorgung: Perspektiven nach 50 Jahren Psychiatrie-Enquete“.
Nach der Eröffnung der Fachtagung durch Sandra Rieck (Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.) und Tina Lindemann (Geschäftsführerin des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e.V.) wurde zur Einstimmung in das Tagungsthema der von der GBS mbH und Frank Köbe produzierte Kurzfilm Zweiffelos präsentiert, der sich mit den Wünschen und Träumen von Menschen mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt.
Im Anschluss gab Prof. Dr. Katarina Stengler (Helios Park-Klinikum Leipzig) in ihrem Impulsvortrag einen Überblick zu den aktuellen Herausforderungen in der sozialen und beruflichen Teilhabe von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Prof. Dr. Astrid Jörns-Presentati (IU Internationale Hochschule Hamburg) ging auf die Notwendigkeit von kooperativen Behandlungs- und Unterstützungsformen in der psychiatrischen Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ein.

Nach den einführenden Vorträgen hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit drei Symposien zu besuchen. Das erste Symposium beschäftigte sich mit kooperativen Versorgungsmodellen bei psychisch belasteten Kindern, Jugendlichen und Familien. Hierzu gab Prof. Dr. Michael Kölch (Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter der Universitätsmedizin Rostock) einen Einblick in die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven von kooperativen Behandlungs- und Unterstützungsformen für psychisch belastete Kinder, Jugendliche und Familien. Prof. Dr. Astrid Jörns-Presentati widmete sich ausgehend von wissenschaftlichen Kooperationsstudien mit kooperativen Versorgungsmodellen in der Kinder- und Jugendhilfe/ Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Kindern und Jugendlichen mit komplexen Unterstützungsbedarfen und herausfordernden Verhaltensweisen (Systemsprenger*innen). Dr. Tina Schlüter (Chefärztin der Außenstellen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie, Klinikum am Weissenhof) berichtete über aufsuchende Behandlungsformen in der psychiatrischen Versorgung von psychisch erkrankten Kindern, Jugendlichen und Familien. Zum Abschluss gaben Dr. Kristin Pomowski und Anke Wagner (Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.) Einblicke in die Arbeit der Landesfachstelle: KipsFam und in das Modellprojekt Mental Health Community M-V des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Das zweite Symposium beschäftigte sich mit kooperativen Behandlungs- und Unterstützungsformen in der Erwachsenenpsychiatrie. Hierzu stelten Nils Greve (Vorstandsvorsitzende des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e.V.) und Dr. Elke Prestin (NetzG – Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V., ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt GBV) das Projekt “Gemeindepsychiatrische Basisversorgung” des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie vor. Mit dem Projekt wurden im Zeitraum von 2019 bis 2022 gemäß der S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ die „gemeindepsychiatrischen Systeminterventionen“ in ausgewählten Regionen erprobt. Dr. Klaus Obert beschäftigte sich dagegen in seinem Vortrag mit der gemeindepsychiatrischen Versorgung von Patient*innen aus der Forensik. Dabei berichtete er über die Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der forensischen Nachsorge im Gemeindepsychiatrischen Verbund Stuttgart. Am Ende ging Prof. Dr. Andreas Speck (Hochschule Neubrandenburg) auf das Thema Einsamkeit als gesellschaftliches und politisches Phänomen und auf die soziale Exklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein.
Zum Abschluss des Modellprojektes “Individual Placement and Support-Coaching – Zurück ins Berufsleben (IPS-ZIB)”, das das Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. gemeinsam mit dem Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V. und vielen weiteren Kooperationspartner*innen zwischen 2020 und 2025 umsetzte, fand ein dritte Symposium zum Thema berufliche Teilhabe statt. Im Zuge des Projektes wurde ein IPS-Coaching (Individual Placement and Support), das sich am evidenzbasierten Konzept des Supported Employment orientiert, in der Region Greifswald, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in der Region Bielefeld erprobt und wissenschaftlich evaluiert. Dabei handelt es sich um ein individuell zugeschnittenes Rehabilitationsarrangement, das von einem Jobcoach begleitet und zusätzlich durch ein flexibles Maßnahme-Budget flankiert wird. Zielgruppe der Maßnahme sind Personen mit psychotischen oder affektiven Störungen und mit komplexem Unterstützungsbedarf, für die eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit besteht. In dem Symposium gaben Prof. Dr. Ingmar Steinhart (Direktor Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V., An-Institut der Universität Greifswald) und Prof. Dr. Katarina Stengler (Helios Park-Klinikum Leipzig) unter Beteiligung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Projektpartner*innen einen Überblick zur Projektumsetzung und den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitforschung.
Wir bedanken uns bei allen Referent*innen und Teilnehmer*innen für die gelungene Festveranstaltung und Fachtagung. Alle Präsentationen zur Fachtagung und alle aufgenommen Videovorträge aus dem Symposium zwei finden Sie hier im internen Mitgliederbereich des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e.V.